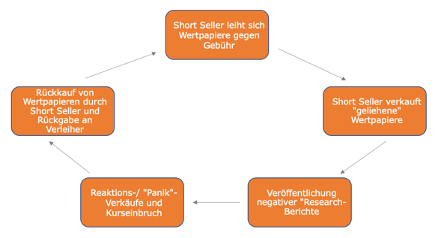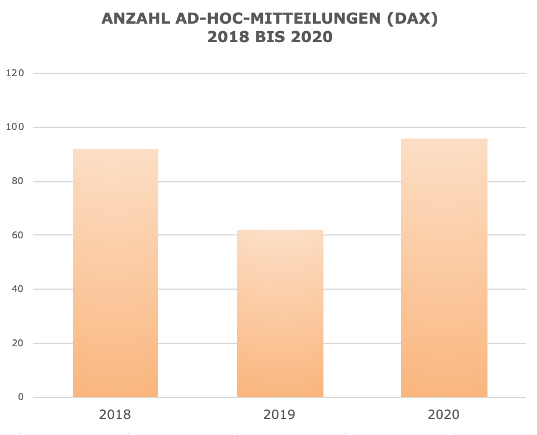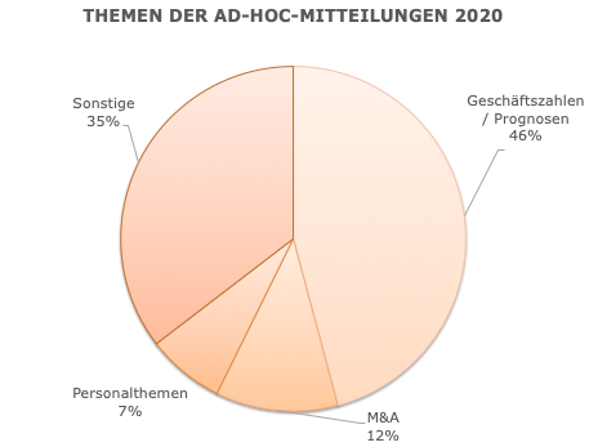Wie die Mutter, so die Tochter? Neuigkeiten vom EuGH zur kartellzivilrechtlichen "Konzernhaftung"

18. Juni 2021
Der Europäische Gerichtshof ("EuGH") hat sich mittlerweile in einer Vielzahl von Entscheidungen zu Fragen des Kartellschadensersatzrechts geäußert und dessen europarechtliche Akzentuierung stetig vorangetrieben. Was in konzerndimensionaler Hinsicht mit "Skanska" (C‑724/17) begonnen hatte, dürfte durch das Vorabentscheidungsverfahren in der Rechtssache "Sumal" (C-882/19) eine weitere Konturierung erfahren und die private Rechtsdurchsetzung zu Gunsten von Geschädigten eines Kartells (vermutlich) weiter stärken. Die Rede ist von der Frage, wer nach den Grundsätzen des funktionalen Unternehmensbegriffs im Kartellschadensersatzprozess passivlegitimiert ist. Dies ist unproblematisch, wenn sich ein potentiell Geschädigter mit seinem Schadensersatzbegehren direkt an den Adressaten der kartellbehördlichen Bußgeldentscheidung wendet. Ungleich schwieriger ist die Frage nach der Passivlegitimation zu beantworten, wenn sich der Kläger nicht an den jeweiligen Adressaten, sondern an die am Kartellrechtsverstoß unbeteiligte Mutter- oder Tochtergesellschaft wendet. Mittlerweile liegen die Schlussanträge des Generalanwalts Pitruzzella in dem Vorabentscheidungsverfahren "Sumal" vor und liefern (zumindest vorläufige) Antworten auf diese Frage(n). Zusammengefasst votiert GA Pitruzzella sowohl für eine "aufsteigende" gesamtschuldnerische Haftung der Mutter- für die Tochtergesellschaft als auch für eine "absteigende" gesamtschuldnerische Haftung der Tochter- für die Muttergesellschaft im schadensersatzrechtlichen Kontext dann, wenn die Voraussetzungen für die Annahme einer wirtschaftlichen Einheit vorliegen und die Tochter einen Beitrag zu dem Kartellrechtsverstoß der Muttergesellschaft geleistet hat.
I. HINTERGRUND DES VORLAGEBESCHLUSSES
Der spanische Containerhersteller Sumal, S.L. (Sumal) verklagte Mercedes Benz Trucks España, S.L. (MBTE), eine spanische Tochtergesellschaft der deutschen Daimler AG (Daimler), auf Schadensersatz in Höhe von EUR 22.204,35. Ausgangspunkt des Schadensersatzbegehrs von Sumal bilden die am 19. Juli 2016 erlassenen Bußgeldbescheide im LKW-Kartell, wonach die Europäische Kommission aufgrund wettbewerbswidriger Preisabsprachen namhafter LKW-Hersteller, u.a. Daimler, Bußgelder i.H.v. EUR 2,93 Mrd. verhängte. Die Klage von Sumal wurde vom Gericht der ersten Instanz aufgrund fehlender Passivlegitimation von MBTE als unzulässig abgewiesen. Die Richter argumentierten, dass Daimler als Muttergesellschaft des Konzerns den Kartellrechtsverstoß begangen habe und nicht deren spanische Tochtergesellschaft MBTE. Aufgrund divergierender Urteile spanischer Gerichte zur Frage der Passivlegitimation, hat das Berufungsgericht dem EuGH im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens die Frage vorgelegt, ob auch die (unbeteiligte) Tochter- für den Kartellrechtsverstoß der Muttergesellschaft gesamtschuldnerisch hafte.
II. "AUFSTEIGENDE HAFTUNG" DER MUTTER- FÜR DIE TOCHTERGESELLSCHAFT?
Die gesamtschuldnerische Haftung einer Mutter- für den Kartellrechtsverstoß ihrer Toch-tergesellschaft ist im Kartellbußgeldverfahren seit langem anerkannt. Möglich ist die Zu-rechnung kartellrechtswidrigen Verhaltens durch die Feststellung der wirtschaftlichen Ein-heit, wonach mehrere rechtlich voneinander unabhängige Unternehmen als ein Unter-nehmen i.S.d. Art. 101 AEUV angesehen werden, wenn sie auf dem jeweils zu identifi-zierenden Markt einheitlich handeln. Damit weist das Kartellrecht einen eigenständigen Unternehmensbegriff auf, der unabhängig vom gesellschaftsrechtlichen Trennungsprinzip besteht. Ausgangspunkt zur Bestimmung der wirtschaftlichen Einheit ist der bestimmen-de Einfluss der Mutter- über die Tochtergesellschaft. Dieser führt letztlich dazu, dass die Tochtergesellschaft (trotz eigener Rechtspersönlichkeit) nicht als am Markt autonom agierendes Unternehmen angesehen wird, weil es im Wesentlichen die Weisungen der Muttergesellschaft befolgt. Unproblematisch kann der bestimmende Einfluss (widerleg-bar) vermutet werden, wenn die Muttergesellschaft direkt oder über eine ununterbroche-ne Kette (mittelbar) eine nahezu 100% ige Beteiligung an der Tochtergesellschaft oder sämtliche mit den Aktien der Tochtergesellschaft verbundene stimmberechtigte Anteile hält. Die Theorie der wirtschaftlichen Einheit wurde durch die Europäische Kommission seit den 1970er Jahren beständig fortentwickelt. Gleichzeitig wurden die Kriterien, die zur Bestimmung der wirtschaftlichen Einheit herangezogen werden, erweitert. So ist im Rahmen des bestimmenden Einflusses als Grundvoraussetzung vor allem die Bewertung der wirtschaftlichen, organisatorischen und rechtlichen Bindungen zwischen den jeweiligen Gesellschaften entscheidend, wenn es um die Beurteilung geht, ob zwei (oder mehrere) Gesellschaften sich am Markt einheitlich verhalten (= wirtschaftliche Einheit).
In der Rechtssache "Skanska" (C-724/17) hat der EuGH die entscheidenden Wertungen in Bezug auf die Bestimmung der wirtschaftlichen Einheit auf das Kartellschadensersatz-recht übertragen. Die Verantwortlichkeit für Kartellrechtsverstöße, sprich die Passivlegi-timation, werde unmittelbar durch Art. 101 AEUV determiniert. Folglich gelte sowohl im public enforcement als auch im private enforcement der funktionale Unternehmensbegriff gleichermaßen. Die wirtschaftliche Einheit, die rechtlich aus mehreren natürlichen oder juristischen Personen bestehen kann, ist nicht nur einheitlicher Urheber der Zuwiderhand-lung und damit bußgeldrechtlich gesamtschuldnerisch verantwortlich, sondern haftet auch zivilrechtlich für die entstandenen Schäden gegenüber den Geschädigten gemeinsam. Aufgrund der besonderen Sachverhaltskonstellation in "Skanska", bei der es im Kern um die Frage der Haftung des Rechtsnachfolgers eines Kartellteilnehmers ging, wurde eine allgemeine zivilrechtliche Haftung der Mutter- für die Tochtergesellschaft nicht expressis verbis festgestellt. Gleichwohl wurde das Urteil in der kartellrechtlichen Praxis vielfach in eben diesem Sinne interpretiert, da die Argumentation des EuGH maßgeblich darauf ba-sierte, dass die wirtschaftliche Einheit als Ganzes hafte. Über den Fall "Skanska" hinaus-gedacht läuft dies konsequenterweise auf eine gesamtschuldnerische, aufsteigende Haf-tung der Mutter- für die Tochtergesellschaft auch im schadensersatzrechtlichen Kontext hinaus. Dieser Leseart schließt sich nun auch GA Pitruzzella ausdrücklich mit der Fest-stellung an, "[…] dass die Tragweite des Begriffs der wirtschaftlichen Einheit, […], nicht nur dann gilt, wenn die Kommission den Umfang des für die Zuwiderhandlung gegen die Wettbewerbsregeln verantwortlichen Unternehmens und Rechtsträger bestimmt, die in-nerhalb dieses Umfangs gesamtschuldnerisch für die verhängten Sanktionen haften, son-dern auch dann, wenn die durch ein wettbewerbswidriges Verhalten eines Unternehmens im Sinne des Wettbewerbsrechts geschädigten Einzelpersonen die zivilrechtliche Scha-densersatzklage erheben." Auf Basis der festgestellten Grenzen der wirtschaftlichen Ein-heit könne der Betroffene daher wählen, an welche rechtliche Einheit sich das Schadens-ersatzbegehr innerhalb der wirtschaftlichen Einheit richte.
III. "ABSTEIGENDE HAFTUNG" DER TOCHTER- FÜR DIE MUTTERGESELLSCHAFT?
Ausgehend von der Feststellung, dass innerhalb einer wirtschaftlichen Einheit eine aufsteigende gesamtschuldnerische Haftung für die private Rechtsdurchsetzung gelte, spricht sich GA Pitruzzella auch für eine absteigende Haftung innerhalb der wirtschaftlichen Einheit aus. Ausgangspunkt für die Bestimmung der wirtschaftlichen Einheit sei dabei stets der bestimmende Einfluss der Mutter- auf die Geschäftspolitik der Tochtergesellschaft. Bezöge man sich jedoch ausschließlich auf den bestimmenden Einfluss zur Begründung der Haftung innerhalb einer wirtschaftlichen Einheit, wäre für eine Haftung der (unbeteiligten) Tochter- für das Verhalten der Muttergesellschaft kein Raum. Definitionsgemäß übe die Tochter- nämlich nie einen bestimmenden Einfluss auf ihre Muttergesellschaft aus. Anknüpfungspunkt könne daher nur das einheitliche Verhalten am Markt zwischen den Trägern der wirtschaftlichen Einheit sein, um eine absteigende Haftung (der Tochter- für die Muttergesellschaft) zu begründen.
Damit ein Kartellrechtsverstoß der Mutter- ihrer Tochtergesellschaft zugerechnet werden könne, müsse sich die Tochtergesellschaft somit grundsätzlich an der wirtschaftlichen Tätigkeit des Unternehmens beteiligt haben, das von der kartellrechtswidrig handelnden Muttergesellschaft geleitet werde. Im Falle der absteigenden Haftung könne sich die Einheitlichkeit der wirtschaftlichen Tätigkeit im Wesentlichen nur daraus ergeben, dass "[…] die Tätigkeit der Tochtergesellschaft gewissermaßen für die Verwirklichung des wettbewerbswidrigen Verhaltens erforderlich ist (z. B. weil die Tochtergesellschaft die kartellbefangenen Güter verkauft)". Damit wird keine Notwendigkeit einer eigenen, originären Beteiligung der Tochter- an dem Kartellrechtsverstoß der Muttergesellschaft gefordert. Ihr Verhalten müsse aber dazu beigetragen haben, dass der Wettbewerbsverstoß umgesetzt wurde, mit anderen Worten, "dass [die Tochtergesellschaft] durch ihr Marktverhalten die Konkretisierung der Auswirkung der Zuwiderhandlung ermöglicht hat." Erst wenn diese Voraussetzung erfüllt sei, haften Mutter- und Tochtergesellschaft als Gesamtschuldner.
Die Schlussanträge von GA Pitruzzella stellen ein Novum in der Haftungszurechnung dar. In absteigender Linie muss neben dem bestimmenden Einfluss eine Beteiligung der Tochter- am Kartellrechtsverstoß der Muttergesellschaft dergestalt festgestellt werden, dass aufgrund des einheitlichen Verhaltens am Markt die Tochtergesellschaft die kartellbetroffenen Waren abgesetzt und dadurch den Kartellrechtsverstoß verwirklicht hat.
IV. EINORDNUNG UND AUSBLICK
Die Schlussanträge sind ein weiterer Beleg dafür, dass die private Rechtsdurchsetzung für die Sicherstellung der vollen Wirksamkeit des Art. 101 AEUV als integral angesehen wird. Sollte sich der EuGH den Ausführungen von GA Pitruzzella anschließen, würde sich die unmittelbar durch das Primärrecht determinierte zivilrechtliche Haftungsverantwortlichkeit grundsätzlich auf die wirtschaftliche Einheit und, im Falle einer Haftung in absteigender Linie, auf die Tochtergesellschaft innerhalb der wirtschaftlichen Einheit erstrecken, die einen Beitrag zu dem Kartellrechtsverstoß der Muttergesellschaft geleistet hat.
Unterschiedliche wirtschaftliche Einheiten innerhalb eines Konzerns
In konsequenter Anwendung der Feststellungen des Generalanwalts könnte es innerhalb eines Konzerns damit unterschiedliche wirtschaftliche Einheiten geben. Während sich der Konzern nach den gesellschaftsrechtlichen Wertungen bestimmt, folgt die Bestimmung der wirtschaftlichen Einheit dem kartellrechtlichen, funktionalen Unternehmensbegriff. Welche einzelnen Konzerngesellschaften zu einer wirtschaftlichen Einheit zusammenzufassen sind, würde sich danach bestimmen, ob diese auf einem sachlich und geografisch zu bestimmenden Markt einheitlich auftreten.
Haftung aller Träger der wirtschaftlichen Einheit?
Da Ausgangspunkt für die Haftung nach der Vorstellung des Generalanwalts die Zugehörigkeit zu der wirtschaftlichen Einheit ist, müssen die vom Generalanwalt formulierten, die Haftung konstituierenden Voraussetzungen in absteigender Hinsicht in der Praxis konsequent angewandt werden, um einer ausufernden Haftung entgegenzuwirken. Danach bedarf es auch unter Zugrundelegung der Überlegungen des Generalanwalts der Feststellung, dass die Tochtergesellschaft wesentlich zu der Verwirklichung des mit dem Kartellrechtsverstoß verbundenen Ziels und dem Eintritt der Auswirkungen der Zuwiderhandlung beigetragen hat. Nach Ansicht des Generalanwalts soll hierfür etwa der Absatz kartellbetroffener Produkte als Kriterium in Betracht kommen.
Auch wenn die Sichtweise des Generalanwalts auf den ersten Blick einleuchten mag, ergeben sich auf den zweiten Blick doch erhebliche Zweifel, ob bereits der bloße Verwirklichungsbeitrag eine schadensersatzrechtliche Haftung der nicht am Kartellrechtsverstoß beteiligten Tochtergesellschaft auslösen kann. Dies gilt umso mehr, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Tochtergesellschaft in dieser Situation ähnlich einem undolosen Werkzeug handelt, welches weder Wissen noch Wollen in Bezug auf den Kartellrechtsverstoß aufweist und darüber hinaus dem bestimmenden Einfluss der Muttergesellschaft unterliegt. Ein Blick auf die Entscheidung des EuGH in der Rechtssache "VM Remonts" (C-542/14) zeigt zudem, dass die Sichtweise des Generalanwalts nicht zwingend ist. In "VM Remonts" setzte sich der EuGH mit der Frage auseinander, wann ein (unbeteiligtes) Unternehmen für die Beteiligung eines selbstständigen (nicht konzernverbundenen) Dienstleisters an einer abgestimmten Verhaltensweise nach Art. 101 AEUV verantwortlich gemacht werden kann. Insofern stellte der EuGH fest, dass, soweit keine Kontrolle über den kartellrechtswidrig handelnden Dienstleister besteht, eine Verantwortlichkeit für dessen Verhalten nur in Betracht komme, wenn das unbeteiligte Unternehmen Kenntnis von dem Kartellrechtsverstoß hatte, diesen bewusst gefördert oder zumindest hätte vorhersehen können. Überträgt man die Konstellation aus dem Verfahren "VM Remonts" auf die absteigende Haftung hätte dies zur Folge, dass eine Haftung nur dann in Betracht kommt, wenn die Tochtergesellschaft (i) die Muttergesellschaft kontrolliert (was definitionsgemäß ausgeschlossen ist, siehe oben), (ii) die Tochter- von dem Kartellrechtsverstoß der Muttergesellschaft Kenntnis hatte bzw. diesen fördern wollte oder, wenn (iii) der Kartellrechtsverstoß der Mutter- für die Tochtergesellschaft vorhersehbar war. Sofern weder Wissen noch Wollen bzw. eine Vorhersehbarkeit auf Seiten der Tochtergesellschaft festgestellt werden kann, sprechen trotz bestehender Kontrolle der Mutter- über die Tochtergesellschaft vor allem auch Gesichtspunkte des Eigentums- und Investitionsschutzes gegen eine Haftung der Tochter- für den Kartellrechtsverstoß der Muttergesellschaft, insbesondere wenn die Mutter- nicht zugleich 100% der Anteile an der Tochtergesellschaft hält. Andernfalls werden Minderheitsgesellschafter der haftenden Tochtergesellschaft erheblichen finanzielle Risiken für Handlungen ausgesetzt, von denen das haftende Rechtssubjekt selbst keine Kenntnis hatte und die zudem dem Einfluss der Anteilseigner gänzlich entzogen sind.
Eine derartige "Beschränkung" der Haftung einer unbeteiligten Tochtergesellschaft ist auch mit dem Interesse potentieller Kläger vereinbar, möglichst umfassend und effektiv Rechtsschutz zu erlangen. Sofern die (eingeschränkten) Voraussetzungen einer absteigenden Haftung vorliegen, ist die Inanspruchnahme einer Tochtergesellschaft durch Geschädigte des Kartellrechtsverstoßes der jeweiligen Muttergesellschaft zwar grundsätzlich denkbar. Sind die Voraussetzungen hingegen nicht gegeben, sondern liegt lediglich ein isolierter Verwirklichungsbeitrag der Tochtergesellschaft vor, vermag die Sichtweise des Generalanwalts nicht plausibel zu begründen, wieso sich potentiell Geschädigte nicht primär an den Kartellanten (sprich die Muttergesellschaft) halten müssen. Dies gilt umso mehr, wenn berechtigte Eigentums- und Investitionsinteressen Dritter berührt werden. Vor diesem Hintergrund sprechen die gewichtigeren Gründe für eine weitergehende Einschränkung der Verantwortlichkeit der Tochtergesellschaft für Verstöße der Muttergesellschaft als sie der Generalanwalt aktuell vorschlägt.
In letzter Konsequenz bedeuten die Ausführungen des Generalanwalts, dass sich für die zivilrechtliche Haftung die wirtschaftliche Einheit durch den notwendigen "Verwirklichungsbeitrag" der Tochtergesellschaft situativ und marktbezogen bestimmen lassen muss. Für eine rein schematische Betrachtung dergestalt, dass grundsätzlich jeder Träger einer wirtschaftlichen Einheit stets und automatisch in kartellschadensersatzrechtlichen Fallgestaltungen haftet, ist damit kein Raum.
Erstreckung der Haftung auf Schwestergesellschaften?
Auf Basis der Argumentation von GA Pitruzzella in der Rechtssache "Sumal" und der des EuGH in der Rechtssache "Skanska" lassen sich noch keine Aussagen zu der Frage der Haftung von Schwestergesellschaften innerhalb eines Konzerns treffen. Legt man die Überlegungen des Generalanwalts zugrunde, wäre eine gesamtschuldnerische Haftung in absteigender Linie jedenfalls dann abzulehnen, wenn eine Schwestergesellschaft in Anspruch genommen wird, die zwar ebenfalls unter dem bestimmenden Einfluss der Muttergesellschaft steht, aber gleichsam nicht auf dem gleichen sachlich und räumlich relevanten Markt tätig ist, etwa weil diese, auf den vorliegenden Fall übertragen, (nicht kartellbetroffene) PKW vertreibt. Dieses Ergebnis lässt sich ferner mit der Schlussfolgerung plausibilisieren, dass es innerhalb eines Konzerns mehrere wirtschaftliche Einheiten geben kann und es für die Bewertung jeweils auf die situativen und marktbezogenen Umstände des Einzelfalls ankommt.
Ausblick
Das Urteil des EuGH wird eine weitere Weichenstellung für das private enforcement bringen und wird daher von der Kartellrechtspraxis mit Spannung erwartet. Unterstellt, dass sich die Luxemburger Richter den Schlussanträgen anschließen, würde die private Rechtsdurchsetzung für Geschädigte eines Kartells durch die "Ausdehnung" der Passivlegitimation ein weiteres Mal gestärkt. Vor dem Hintergrund der Aussage des EuGH in der Rechtssache "Skanska", wonach "Schadensersatzklagen wegen Verstoßes gegen die Wettbewerbsregeln der Union […] einen integralen Bestandteil des Systems zur Durchsetzung dieser Vorschriften [bilden]", erscheint es zumindest wahrscheinlich, dass der EuGH sich der Sichtweise des Generalanwalts anschließen könnte. Gleichwohl bleibt festzuhalten, dass auch im Falle einer solchen Entscheidung die Passivlegitimation in Zukunft keinen Automatismus im Sinne einer unbesehenen Haftung der wirtschaftlichen Einheit darstellen wird. Vielmehr wird weiterhin anhand des konkreten Einzelfalls zu prüfen sein, wen ein potentiell Geschädigter, v.a. in absteigender Linie, tatsächlich im Zusammenhang mit kartellschadensersatzrechtlichen Forderungen in Anspruch nehmen kann.
Der Beitrag steht hier für Sie zum Download bereit: Wie die Mutter, so die Tochter? Neuigkeiten vom EuGH zur kartellzivilrechtlichen "Konzernhaftung"