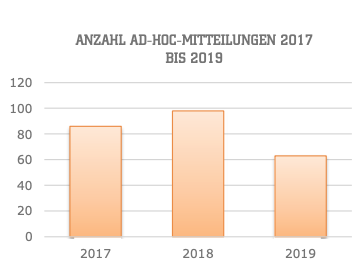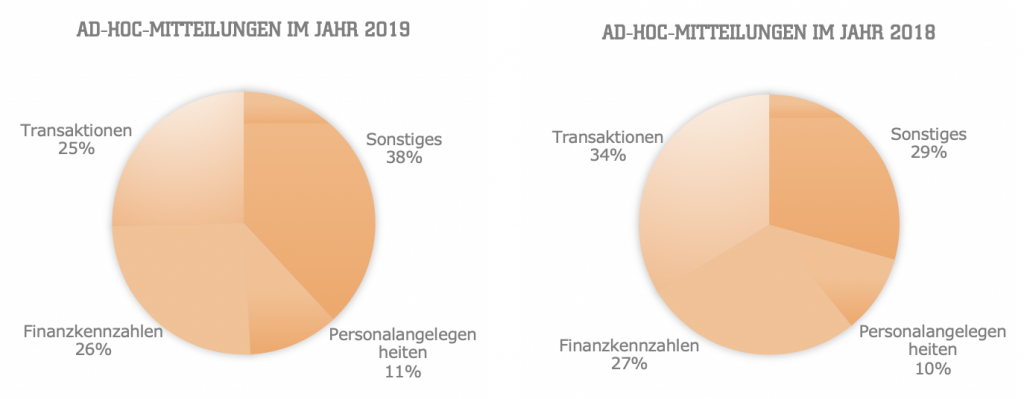"Otis" - Auf dem Weg zum unionsrechtlichen Schadensersatzanspruch?

5. März 2020
In einem am 12. Dezember 2019 erlassenen Urteil in der Sache "Otis" (C-435/18) hatte der Europäische Gerichtshof ("EuGH") auf Grundlage einer Vorlage des österreichischen Obersten Gerichtshofs ("OGH") erneut die Möglichkeit, zur Reichweite von Schadenersatzansprüchen wegen einer Verletzung des europäischen Kartellrechts Stellung zu nehmen. Dabei kommt der EuGH zu dem Schluss, dass es mit europarechtlichen Vorgaben nicht vereinbar sei, den Kreis der Schadensersatzberechtigten auf Anspruchsteller zu beschränken, die auf dem vom Kartell betroffenen Markt als Anbieter oder Nachfrager tätig sind. Mit dem Urteil setzt der EuGH seinen bereits in den Entscheidungen "Courage" (C-453/99), "Manfredi" (C-295/04 – 298/04), "Kone" (C-557/12) und zuletzt auch "Skanska" (C-724/17) beschrittenen Weg einer europarechtlichen Konturierung kartellrechtlicher Schadensersatzansprüche fort. Wie zuvor bereits die Generalanwältin Kokott scheint der EuGH dabei den Kreis der Schadensersatzberechtigten unmittelbar aus Art. 101 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ("AEUV") abzuleiten und reduziert so die Bedeutung des nationalen Rechts für die Ausgestaltung kartellschadensersatzrechtlicher Ansprüche weiter.
HINTERGRUND DER VORLAGEENTSCHEIDUNG
Der Vorlageentscheidung des OGH (9 Ob 44/17m) lag eine Schadensersatzklage des Landes Oberösterreich gegen Teilnehmer des sog. Aufzugskartells zugrunde. In dessen Rahmen hatten mehrere große Hersteller von Aufzügen und Rolltreppen mindestens seit den 1980er Jahren wettbewerbswidrige Absprachen getroffen, die sich u.a. auf eine Aufteilung des Markts und damit eine Ausschaltung des Wettbewerbs untereinander richteten.
Das Land Oberösterreich war der Ansicht, infolge des Aufzugskartells einen Schaden in Form entgangener Zinsgewinne erlitten zu haben: Bei der Gewährung zinsvergünstigter Darlehen zur Förderung von Bauvorhaben seien die jeweils ausgezahlten Darlehensbeträge infolge der durch das Aufzugskartell überhöhten Baukosten ihrerseits kartellbedingt überhöht gewesen. Entsprechend sei es dem Land verwehrt gewesen, den kartellbedingt zu viel gezahlten Anteil der Darlehensbeträge anderweitig gewinnbringend, d.h. zu einem höheren (marktüblichen) Zins, anzulegen. Der Schaden ergebe sich aus der Differenz zwischen den für den kartellbedingt überhöhten Anteil des Darlehens erhaltenen (niedrigen) Zinsen und den ansonsten am Markt erzielbaren (höheren) Zinserträgen (durchschnittlicher Zinssatz österreichischer Bundesanleihen). Der OGH kam zu dem Ergebnis, dass die geltend gemachten Zinsverluste nach österreichischem Recht nicht ersatzfähig seien. Zwar beruhe der erlittene Schaden auf den wettbewerbswidrigen Absprachen des Aufzugskartells. Allerdings werde ein solcher Schaden nicht vom Schutzzweck des Kartellverbots – namentlich der Erhaltung des Wettbewerbs auf dem kartellbetroffenen Markt – erfasst. Es fehle an einem hinreichenden Zusammenhang zum Kartellrechtsverstoß, weil das Land Oberösterreich in seiner Eigenschaft als Darlehensgeber weder Anbieter noch Nachfrager auf dem betroffenen sachlichen und räumlichen Markt sei. Der (Zins-)Schaden des Landes Oberösterreich sei damit lediglich eine "Seitenwirkung" in einer Interessensphäre, die nach österreichischem Verständnis durch das Kartellverbot nicht geschützt sei.
Angesichts der mit diesem Verständnis verbundenen pauschalen Einschränkung des Kreises der Schadensersatzberechtigten legte der OGH dem EuGH die Frage nach der Vereinbarkeit seiner Auslegung mit europäischem Recht vor.
URTEIL DES EUGH
Der EuGH nimmt die Vorlagefrage des OGH zunächst zum Anlass, seine zentralen Entscheidungen zur Schadensersatzberechtigung wegen Kartellrechtsverstößen zu referieren. Dabei hebt er unter Bezugnahme auf die Entscheidung "Courage" insbesondere hervor, dass zur Sicherstellung der vollen Wirksamkeit des Art. 101 AEUV jedermann Ersatz des Schadens verlangen können müsse, der ihm durch eine wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweise entstanden sei.
Die Wirksamkeit von Art. 101 AEUV sei erheblich beeinträchtigt, wenn – wie im vorgelegten Fall über das Kriterium des Schutzwecks der Norm – der Kreis der Ersatzberechtigten auf "Marktteilnehmer" (Nachfrager und Anbieter auf dem betroffenen Markt) beschränkt werde und damit weiteren potenziell Geschädigten pauschal kartellrechtliche Schadensersatzansprüche versagt würden.
Vor diesem Hintergrund kommt der EuGH zu dem Ergebnis, dass "jeder in einem ursächlichen Zusammenhang mit einer Zuwiderhandlung gegen Art. 101 AEUV stehende Schaden ersatzfähig sein [muss], um die wirksame Anwendung von Art. 101 AEUV sicherzustellen und dessen praktische Wirksamkeit zu erhalten". Insoweit sei es Sache der nationalen Gerichte zu prüfen, ob der behauptete kausale Schaden tatsächlich bewiesen werden kann.
EINORDNUNG UND AUSBLICK
Die Entscheidung "Otis" bestätigt den hohen Stellenwert, den der EuGH der privaten Kartellrechtsdurchsetzung zur Sicherstellung der vollen Wirksamkeit des Art. 101 AEUV beimisst. Eine pauschale Begrenzung des Kreises der Schadensersatzberechtigten auf Marktteilnehmer, wie sie das österreichische Recht vorsieht, ist hiermit nicht vereinbar.
Herleitung eines unionsrechtlichen Schadensersatzanspruchs?
Der EuGH leitet dieses Ergebnis wohl unmittelbar aus Art. 101 AEUV her. Er liegt damit auf der Linie der Entscheidung "Skanska", auch wenn die Ausführungen in "Otis" weniger deutlich sind. In der Entscheidung "Skanska" hatte der EuGH im Anschluss an die Schlussanträge des Generalanwalts Wahl die Passivlegitimation – für die Konstellation eines ansonsten drohenden Haftungsausfalls – ausdrücklich aus dem Primärrecht hergeleitet und dazu unmittelbar an den unionsrechtlichen Unternehmensbegriff aus Art. 101 AEUV angeknüpft. Ein Rückgriff auf den Effektivitätsgrundsatz als Korrektiv etwaiger nationaler Vorschriften zur Passivlegitimation war daher nicht notwendig.
Auch in der Sache "Otis" knüpft der EuGH zur Bestimmung des Kreises der Schadensersatzberechtigten unmittelbar an Art. 101 AEUV an und nimmt weder auf das Effektivitäts- noch das Äquivalenzprinzip ausdrücklich Bezug. Zudem zählt der EuGH die Festlegung von Anwendungsregeln für den Begriff des "ursächlichen Zusammenhangs" – anders als noch in der Entscheidung "Kone" (Rn. 24,25 und 32) – nicht mehr ausdrücklich zu den "Modalitäten für die Ausübung" des Schadensersatzanspruchs, deren Bestimmung den nationalen Rechtsordnungen vorbehalten sei. Dies entspricht im Wesentlichen den Ausführungen der Generalanwältin Kokott. Nach ihrer Einschätzung, die sie bereits in ihren Schlussanträgen im Fall "Kone" geäußert hatte, ist der materielle Schadensersatzanspruch vollständig europarechtlich determiniert, sodass dessen Voraussetzungen unmittelbar aus Art. 101 AEUV folgen. Dem nationalen Recht verbleibe danach lediglich die Ausgestaltung der Modalitäten der (prozessualen) Anspruchsdurchsetzung, die sich allerdings wiederum am europäischen Effektivitäts- und Äquivalenzgrundsatz messen lassen müsse.
Vor diesem Hintergrund hat es gegenwärtig den Anschein, dass der EuGH sich jedenfalls mit Blick auf die Bestimmung des Kreises der Schadensersatzberechtigten der sowohl von Generalanwalt Wahl in "Skanska" als auch von der Generalanwältin Kokott in "Otis" und "Kone" vertretenen unmittelbaren Herleitung der materiellen Anspruchsvoraussetzungen des kartellrechtlichen Schadensersatzes aus Art. 101 AEUV anschließt. Damit entfernt sich der EuGH von seinem ursprünglichen Ansatz, dem nationalen Recht die Ausgestaltung des Schadensersatzanspruchs vorzubehalten und diese lediglich an den Maßstäben der Effektivität und Äquivalenz zu messen. National gewachsene Rechtsprinzipien werden so zurückgedrängt. Ob damit der Weg zu einem originär unionsrechtlichen Schadensersatzanspruch auch im Übrigen vorgezeichnet ist, bleibt abzuwarten. Die Entscheidung "Otis" wird jedenfalls nicht das letzte Wort des EuGH zur unionsrechtlichen Ausgestaltung kartellrechtlicher Schadenersatzansprüche gewesen sein.
Auswirkungen auf die deutsche Rechtslage
In Ansehung des Urteils lohnt sich abschließend ein Blick auf die deutsche Rechtslage. Zwar kennt das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ("GWB") das enge Kriterium des Schutzwecks der Norm für die Begründung des kartellrechtlichen Schadensersatzanspruchs seit der 7. GWB-Novelle nicht mehr. Allerdings ist auch dem geltenden deutschen Recht eine Eingrenzung des Kreises der Schadensersatzberechtigten nicht fremd. Eine dem Schutzweck der Norm nach österreichischem Recht vergleichbare (einschränkende) Wirkung kommt für den kartellrechtlichen Schadensersatzanspruch gemäß § 33a GWB dem in Anlehnung an § 33 Abs. 3 GWB mehrheitlich befürworteten Merkmal der persönlichen "Betroffenheit" zu, das Voraussetzung der Aktivlegitimation sein soll.
Auch bei einer weiten Auslegung dieses Merkmals in Anknüpfung an die "ORWI"-Entscheidung des BGH (KZR 75/10) dürften angesichts der damit einhergehenden pauschalen Einschränkung des Kreises der Anspruchsberechtigten Zweifel an der Vereinbarkeit mit europäischem Kartellrecht laut werden. Insoweit wäre wohl bereits in der kausalen Verbindung zwischen Schaden und Kartellrechtsverstoß eine notwendige, aber zugleich auch hinreichende Grundlage für die Aktivlegitimation zu sehen. Inwieweit dabei dem Kriterium der Adäquanz bzw. der Vorhersehbarkeit zukünftig Bedeutung zukommt, bleibt abzuwarten (vgl. "Kone", Rn. 34). Eine faktische Eingrenzung des Kreises der Ersatzberechtigten ergäbe sich jedenfalls aus den Darlegungs- und Beweisanforderungen, die der Kläger mit abnehmender Nähe zum Schadensereignis ggf. nicht mehr erfüllen könnte.
Der Blogbeitrag steht hier für Sie zum Download bereit: "Otis" - Auf dem Weg zum unionsrechtlichen Schadensersatzanspruch?
KONTAKT
Dr. Max Schulz
Associate | Competition | Rechtsanwalt seit 2018
Kontakt
Telefon: +49 211 20052-360
Telefax: +49 211 20052-100
E-Mail: m.schulz(at)glademichelwirtz.com