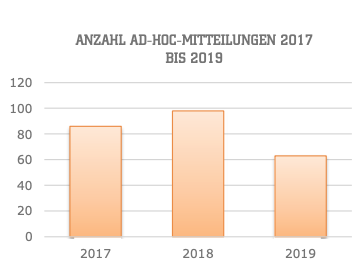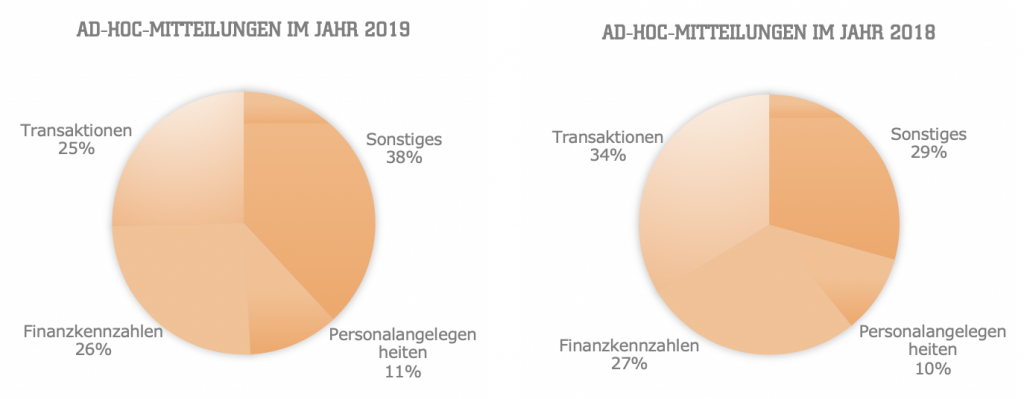Kündigung von Lieferverträgen - Der Fall Prevent gegen VW

16. April 2020
Die vielbeachtete Auseinandersetzung zwischen VW und dem Zulieferer Prevent zieht sich seit 2016. Sie hat mit dem am 5. Februar 2020 ergangenen Urteil des OLG Düsseldorf (Az. U (Kart) 4/19) einen weiteren Höhepunkt erreicht (Hier klicken).
Zwei Konzerngesellschaften von Prevent (Car Trim und ES Guss) hatten im August 2016 die Belieferung von VW eingestellt, um höhere Preise für Sitzteile und Getriebegehäuse durchzusetzen. Es kam zu Produktionsstillständen bei VW. Um die Produktion nicht weiter zu gefährden, gab VW den Preisforderungen nach, baute aber parallel alternative Lieferanten auf. Nach erneuten Preiserhöhungsforderungen kündigte VW 2018 alle Verträge mit Unternehmen der Prevent Gruppe. VW verlangt nach Presseberichten nunmehr Schadensersatz für den Lieferstopp 2016. Prevent TWB ("Prevent") wiederum verlangt von VW und Audi Schadensersatz für die Vertragskündigung 2018. Mit der Klage von Prevent befasst sich das Urteil des OLG Düsseldorf.
Sachverhalt
Im Herbst 2017 forderte Prevent von VW und Audi einen Preisaufschlag von bis zu 25 % für Lieferungen (von Hintersitzrahmen) ab Januar 2018. Prevent rechtfertigte die Preiserhöhung mit einer erwarteten, abschlägigen Entscheidung des VW-Konzerns bei der Vergabe von Nachfolgeprojekten, die eine Neukalkulation erforderlich mache.
VW versuchte in der Folgezeit erfolglos zu klären, welche Konsequenzen Prevent ziehen würde, falls die Preiserhöhungen nicht akzeptiert werden. Prevent hatte sich hierzu nicht klar positioniert, sodass VW und Audi mit einem Lieferstopp rechneten (wie bereits 2016). Aufgrund dessen sprachen VW und Audi Ende März 2018 gegenüber Prevent eine ordentliche Kündigung aller vertraglichen Beziehungen mit einer Frist von 12 Monaten – zum 31. März 2019 – aus. VW erklärte mit Schreiben vom 4. Mai 2018 zudem die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund ebenfalls zum 31. März 2019.
In dem Rechtsstreit machte Prevent geltend, VW und Audi seien aufgrund einer vertraglich in sog. Nomination Letters vereinbarten Bezugspflicht zu einer 100%igen Deckung ihres spezifischen Bedarfs bei Prevent verpflichtet. Diese Quote sei unterschritten worden. Zudem seien VW und Audi auch nach dem 31. März 2019 zur Abnahme der Teile verpflichtet gewesen, weil sie die Vertragsverhältnisse nicht wirksam gekündigt hätten.
Urteil des OLG Düsseldorf
In rechtlicher Hinsicht war zum einen zwischen dem Zeitraum bis 31. März 2019 (angebliches Wirksamwerden der Kündigungen) und ab 1. April 2019 zu differenzieren und zum anderen zwischen den beklagten Unternehmen Audi und VW zu unterscheiden. Das LG Dortmund hatte die Klage von Prevent noch insgesamt abgewiesen; das OLG Düsseldorf sieht das in Bezug auf Audi anders.
Kein Anspruch auf Bezug von 100%
Nach Auffassung des OLG Düsseldorf stehe Prevent gegen VW und Audi wegen des Bezugs von Vertragsprodukten auch bei Dritten weder aus Vertrag (§§ 280 Abs. 1, 3, 281 BGB) noch nach Kartellrecht (§ 33a GWB) Schadensersatz zu. Weder VW noch Audi hätten eine Pflichtverletzung begangen, indem sie ihren Bedarf nicht zu 100%, sondern lediglich zu 80% über Bezüge von Prevent deckten.
Damit stärkt das OLG Düsseldorf die Bedeutung der Nomination Letters. Diese hätten die Bezugspflichten auf 80% des Bedarfs der jeweils eigenen Marken beschränkt. Die Vereinbarung eines Lieferanteils von 80% sei zur Absicherung der kartellrechtlichen Vertragswirksamkeit gewollt gewesen; den Parteien war bewusst, dass der Vertrag bei einer Exklusivbeauftragung angesichts seiner Laufzeit gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Vertikal-GVO nicht nach Art. 101 Abs. 3 AEUV, Art. 2 Vertikal-GVO freigestellt sein würde und deshalb unter Umständen gegen § 1 GWB oder Art. 101 Abs. 1 AEUV verstoßen und nichtig sein würde. Eine solche Vertragsnichtigkeit hätten die Parteien mit der Beauftragung eines Lieferanteils von nur 80% vermeiden wollen.
Ein Verstoß gegen die kartellrechtlichen Missbrauchsvorschriften sei ebenfalls nicht festzustellen. Prevent hatte argumentiert, als Entwicklungspartner von VW maßgeblich zur Entwicklung der Teile beigetragen zu haben und das Teile-Konzept im Zuge des Vertragsschlusses auf VW übertragen zu haben. Dies lies das OLG Düsseldorf als Begründung für eine ausschließliche Bezugspflicht jedoch nicht gelten. Zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses sei VW weder markt-beherrschend auf dem Nachfragemarkt gewesen noch war Prevent abhängig von VW, denn die Produktion der Teile (Hintersitzlehnen) war noch nicht angelaufen.
Ordentliche Kündigungen unwirksam
Einen Anspruch auf Abnahme der produzierten Teile habe Prevent daher nur im Umfang der im Nomination Letter genannten 80% der jeweiligen Markenbedarfe gehabt. Diese Pflicht zur Abnahme der Teile sei nicht durch die ordentlichen Kündigungen entfallen, die VW und Audi erklärt haben.
Ausweislich der Lastenhefte entspreche die Laufzeit des Nomination Letter grundsätzlich der Laufzeit des Bauteils bis EOP (End of Production) zuzüglich der Ersatzteilphase. Die Lastenhefte seien AGB iSv §§ 305 ff. BGB und wirksam einbezogen worden. Ein Recht zur ordentlichen Kündigung habe daher nicht bestanden.
Außerordentliche Kündigung wirksam
Die Wertung des OLG Düsseldorf war misslich für Audi, weil allein VW zusätzlich eine außerordentliche Kündigung erklärt hatte. Diese war gleich mehrfach begründet worden. Das OLG Düsseldorf hielt die geltend gemachte unerlaubte Weitergabe einer vertraulichen VW-Vorstandsvorlage allerdings nicht für ausreichend, weil sich der Weg der Veröffentlichung nicht feststellen ließ. Auch die Forderung der Preiserhöhung ließ das Gericht nicht gelten, weil VW ihr nicht habe zustimmen müssen. Schließlich war das Berufen von VW auf die im Lastenheft genannten außerordentlichen Kündigungsrechte vergeblich. Denn das OLG hält sämtliche dieser außerordentlichen Kündigungsrechte für AGB-rechtlich unwirksam (§ 307 BGB). Sie sähen allein Rechte für VW vor, nicht zugunsten des Lieferanten. Sie enthielten zahlreiche Kündigungserleichterungen und beschränkten sich nicht auf wichtige Gründe. Zudem seien sie nicht auf Gründe aus der Risikosphäre des Lieferanten beschränkt, sondern erlaubten z.B. auch die Kündigung, wenn VW aus wichtigen Gründen auf die Weiterverfolgung des Projekts verzichtet.
Zulässig aber war eine außerordentliche Kündigung aufgrund der impliziten Drohung von Prevent mit einem Lieferstopp. Das Preiserhöhungsverlangen sei unberechtigt gewesen, weil ein Anspruch auf Beauftragung in der Zukunft nicht bestanden habe. Trotz mehrfacher Aufforderung zur Klarstellung habe Prevent die Drohung mit einem Lieferstopp im Raum stehen lassen, was einer "Erpressung" gleichkomme. Eine Abmahnung durch VW sei in dieser Situation entbehrlich gewesen. Dass VW sich auf die Drohung in der Kündigung nicht berufen hatte, war unschädlich, weil im entschiedenen Fall die Voraussetzungen für ein zulässiges Nachschieben von Gründen erfüllt seien.
Die Kündigung sei auch nicht aus kartellrechtlichen Gründen unwirksam, weil auch bei einer unterstellten Normadressateneigenschaft von VW die §§ 19, 20 GWB nicht untersagten, ein Vertragsverhältnis aus wichtigem Grund – erst recht mit Jahresfrist – zu kündigen.
Schlussfolgerung für die Praxis
Für Zulieferunternehmen illustriert das Urteil zunächst, dass Bezugspflichten i.H.v. 80% eines bestimmten Bedarfs kartellrechtlich zulässig und in Übereinstimmung mit der Vertikal-GVO geregelt werden können.
Bei einem Preiserhöhungsverlangen während der Vertragslaufzeit ist Vorsicht hinsichtlich der Kommunikation mit dem Vertragspartner geboten. Nicht anzuraten ist, den Vertragspartner durch Schweigen im Unklaren über die ihm bevorstehenden Folgen einer Zurückweisung der Preiserhöhung zu lassen. Denn ein solches Schweigen kann unter Umständen vom Abnehmer als eine konkludente Drohung mit einem Lieferstopp verstanden werden, die ihn zu einer außerordentlichen Kündigung berechtigen dürfte.
In Lastenheften genannte außerordentliche Kündigungsgründe können der AGB-Kontrolle unterliegen und unwirksam sein. Aus Abnehmerperspektive ist hervorzuheben, dass ein außerordentliches Kündigungsrecht trotz einer etwaigen Normadressatenstellung der §§ 19, 20 GWB grundsätzlich besteht, insbesondere wenn der Zulieferer den Anlass für die außerordentliche Kündigung gesetzt hat. Ob Nachfragemacht besteht, ist jeweils im Zeitpunkt der fraglichen Handlung zu beurteilen.
Um das Vertragsverhältnis durch eine ordentliche Kündigung zu beenden, ist der dem Vertragsverhältnis zugrunde liegende Liefervertrag (zu dem insbesondere Nomination Letter und Lastenheft gehören können) auf eine etwaige Befristung zu untersuchen. Eine die ordentliche Kündigung grundsätzlich ausschließende Befristung liegt auch vor, wenn den Parteien der Eintritt eines den Vertrag beendenden Ereignisses gewiss war und nur dessen Zeitpunkt für die Parteien zur Zeit des Vertragsschlusses noch nicht absehbar war (etwa das EOP).
Der Blogbeitrag steht hier für Sie zum Download bereit: Kündigung von Lieferverträgen - Der Fall Prevent gegen VW
KONTAKT
Dr. Markus Wirtz
Partner | Competition | Rechtsanwalt seit 1999
Kontakt
Telefon: +49 211 20052-110
Telefax: +49 211 20052-100
E-Mail: m.wirtz(at)glademichelwirtz.com