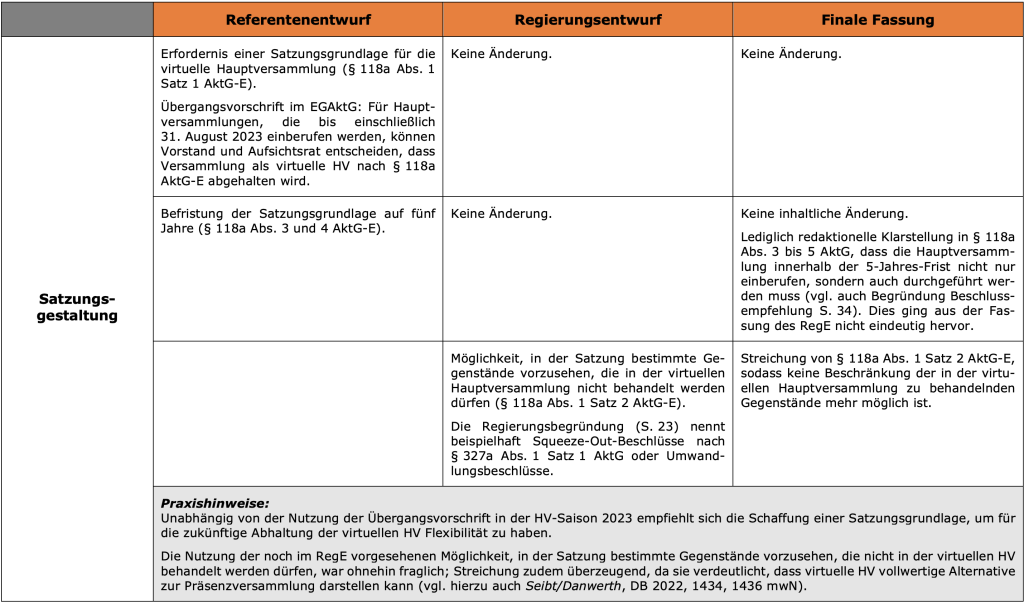Still hot – Neue Entwicklungen bei der kartellrechtlichen Beurteilung von Nachhaltigkeitsvereinbarungen auf europäischer und deutscher Ebene

27. September 2022
Zuletzt hat der Blogbeitrag vom 8. Februar 2021 (hier) aktuelle Entwicklungen bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen im Rahmen des Art. 101 Abs. 3 AEUV und die unterschiedlichen Herangehensweisen nationaler Wettbewerbsbehörden an diese Thematik beleuchtet. Die wettbewerbspolitische und kartellrechtliche Debatte, in welchem Rahmen das Kartellrecht einen Beitrag zur Erreichung von Nachhaltigkeitszielen leisten kann, ist seither um eine Vielzahl neuer Impulse bereichert worden. Während auf europäischer Ebene das Thema im Rahmen gesetzlicher Regelungen bzw. Leitlinien angegangen wird, bestimmt in Deutschland die Entscheidungspraxis des Bundeskartellamts die rechtliche Beurteilung. Dieser Beitrag erläutert die aktuellen Entwicklungen bei der kartellrechtlichen Bewertung von Nachhaltigkeitsvereinbarungen auf europäischer und deutscher Ebene und zeigt Handlungsoptionen für Unternehmen zur rechtssicheren und kartellrechtskonformen Ausgestaltung auf.
I. ENTWURF DER HORIZONTALLEITLINIEN UND FREISTELLUNG VOM KARTELL-VERBOT IM AGRARORGANISATIONENRECHT
In ihrem Competition Policy Brief "Competition Policy in Support of Europe’s Green Ambition" aus September 2021 kündigte die Europäische Kommission ("Kommission") an, im Rahmen der Überarbeitung wichtiger kartellrechtlicher Leitlinien Unternehmen "Guidance" zu Nachhaltigkeitsvereinbarungen an die Hand geben zu wollen. In Umsetzung dessen nahm die Kommission in ihrem Entwurf der Horizontalleitlinien ("Horizontal-LL") ein eigenes Kapitel zu Nachhaltigkeitsvereinbarungen auf. Zudem dürfte auch eine Freistellung vom Kartellverbot im Agrarorganisationenrecht horizontalen und vertikalen Initiativen für Nachhaltigkeit neue Spielräume eröffnen.
1. Nachhaltigkeitsvereinbarungen im Entwurf der Horizontal-LL
Nachhaltigkeitsvereinbarungen werden im Entwurf der Horizontal-LL als Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern definiert, die ein oder mehrere Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Zu diesen weit gefassten Nachhaltigkeitszielen zählt die Kommission unter anderem die Bekämpfung des Klimawandels, die Vermeidung von Umweltverschmutzung oder die Gewährleistung des Tierschutzes. Ein besonderes Augenmerk legt die Kommission in dem Entwurf der Horizontal-LL auf Nachhaltigkeitsvereinbarungen, durch die Nachhaltigkeitsstandards festgelegt werden. Solche Vereinbarungen zu Nachhaltigkeitsstandards sollen unter sieben kumulativ genannten Voraussetzungen bereits keine Wettbewerbsbeschränkung i.S.d. Art. 101 Abs. 1 AEUV darstellen. Für den Fall, dass eine Nachhaltigkeitsvereinbarung in den Anwendungsbereich des Kartellverbots fällt, erläutert die Kommission, wie die vier Voraussetzungen der Einzelfreistellung nach Art. 101 Abs. 3 AEUV in Bezug auf Nachhaltigkeitsvereinbarungen auszulegen und anzuwenden sind. Dabei bringt der Entwurf der Kommission bezogen auf die beiden in dem vorausgegangenen Blogbeitrag diskutierten Voraussetzungen "Nachhaltigkeitsverbesserungen als Effizienzgewinne" und "angemessene Verbraucherbeteiligung" mehr Rechtsklarheit und Rechtssicherheit.
Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang zunächst die Klarstellung der Kommission, auch Nachhaltigkeitsverbesserungen wie eine geringere Umweltverschmutzung oder die längere Haltbarkeit nachhaltig hergestellter Produkte seien als qualitative Effizienzgewinne grundsätzlich berücksichtigungsfähig. Da dies die Unternehmen jedoch nicht von einem Nachweis der Effizienzgewinne entbindet, die objektiv, konkret und nachprüfbar sein müssen, dürften die entsprechenden Nachweisanforderungen auch aufgrund der teilweise komplexen ökonomischen Modelle eine Herausforderung für die betroffenen Unternehmen und die kartellrechtliche Praxis darstellen. Hierfür hält der Entwurf der Horizontal-LL keine konkreten Lösungen bereit, sondern verweist auf die erst noch zu entwickelnde Fallpraxis, die auch zu belastbaren Bewertungsmethoden führen könnte.
Ferner stellt die Kommission klar, dass die insbesondere bei Nachhaltigkeitsvereinbarungen auftretenden kollektiven Gewinne, die auf einem anderem als dem von der Wettbewerbsbeschränkung betroffenen Markt eintreten, grundsätzlich im Rahmen von Art. 101 Abs. 3 AEUV zu berücksichtigten sind. Die Kommission fordert jedoch für die Berücksichtigung kollektiver Verbrauchervorteile ein hohes Maß an Überschneidung zwischen den von der Beschränkung betroffenen und der von den Effizienzgewinnen begünstigten Verbrauchergruppe. Insoweit bleibt die Kommission im Grundsatz ihrer bisherigen Praxis treu, eine angemessene Beteiligung der Verbraucher auf dem betroffenen Markt vorauszusetzen. Darüber hinaus verlangt die Kommission für eine "angemessene Verbraucherbeteiligung", dass die Gesamtwirkungen auf die Verbraucher auf dem betroffenen Markt zumindest neutral sein müssen. Damit positioniert sich die Kommission deutlich zurückhaltender als beispielsweise die niederländische Wettbewerbsbehörde Autoreit Consument & Markt, die sich für eine stärkere Berücksichtigung kollektiver Vorteile jenseits des betroffenen Marktes sowie gegen die Notwendigkeit einer vollen Kompensation der Verbraucher auf dem betroffenen Markt ausspricht.
2. Mehr Nachhaltigkeit im Agrarsektor: Freistellung vom Kartellverbot
Von besonderer Bedeutung für das Erreichen von Nachhaltigkeitszielen im Agrarsektor dürfte der Ende 2021 in Erweiterung der VO Nr. 1308/2013 in Kraft getretene Art. 210 a über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse ("GMO") sein. Danach findet das Kartellverbot aus Art. 101 Abs. 1 AEUV keine Anwendung auf Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen von Erzeugern landwirtschaftlicher Erzeugnisse, die sich auf die Erzeugung landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder den Handel mit diesen beziehen und darauf abzielen, einen höheren Nachhaltigkeitsstandard anzuwenden, als er durch das Unionsrecht oder nationales Recht vorgeschrieben ist. Diese Freistellung gilt jedoch nur, wenn mit diesen Vereinbarungen, Beschlüssen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen lediglich Wettbewerbsbeschränkungen auferlegt werden, die für das Erreichen des höheren Nachhaltigkeitsstandards unerlässlich sind. Die Ausnahme ist nicht auf die Erzeugerebene beschränkt, sondern gilt auch für wettbewerbsbeschränkende Verhaltensweisen zwischen Erzeugern und Unternehmen auf verschiedenen Stufen der Erzeugung, der Verarbeitung und des Handels der Lebensmittelversorgungskette.
II. VON BANANEN, RINDERN UND MILCH – NACHHALTIGKEITSINITIATIVEN IN DER FALLPRAXIS DES BUNDESKARTELLAMTS
Im Gegensatz zur Kommission verfolgt das Bundeskartellamt weiterhin den Ansatz, Nachhaltigkeitsinitiativen im Rahmen des Aufgreifermessens im Einzelfall zu prüfen und "Guidance" für Unternehmen "lediglich" anhand der Fallpraxis bereitzustellen. In jüngster Zeit hat das Bundeskartellamt seine Bewertung von vier Nachhaltigkeitsinitiativen veröffentlicht, die alle im Lebensmittelbereich zu verorten sind. Drei dieser Initiativen erhielten vom Bundeskartellamt grünes Licht, während die vom Agrardialog Milch vorgeschlagenen Preisaufschläge zugunsten der Rohmilcherzeuger das Bundeskartellamt nicht überzeugen konnten.
So hatte das Bundeskartellamt keine wettbewerblichen Bedenken gegen die Nachhaltigkeitsinitiative der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ("GIZ") sowie der Arbeitsgruppe des deutschen Einzelhandels zur Förderung existenzsichernder Löhne (Living Wages). Ein Ziel der Initiative ist die freiwillige Selbstverpflichtung der teilnehmenden Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels, bis 2025 möglichst 50 Prozent der in Deutschland als Eigenmarken verkauften Bananen entsprechend der sogenannten Living Wages-Kriterien abzusetzen. Zudem will die Initiative die gemeinsame Einführung verantwortungsvoller Beschaffungspraktiken sowie die Entwicklung von Prozessen zum Monitoring transparenter Löhne vorantreiben. Für die positive kartellrechtliche Beurteilung war insbesondere entscheidend, dass im Zusammenhang mit der Initiative kein Informationsaustausch zu Einkaufspreisen, Kosten, Produktionsmengen oder Margen stattfindet. Zudem war aus Sicht des Bundeskartellamts von Relevanz, dass durch die Initiative keine verpflichtenden Mindestpreise, Preisaufschläge oder sonstigen Vorgaben eingeführt werden, wie die höheren Kosten entlang der Lieferkette weitergegeben werden und es deshalb nicht zu einer faktischen Preisbindung der zweiten Hand kommt.
Zudem hatte das Bundeskartellamt gegen die Erweiterung der Initiative Tierwohl ("ITW"), mit der sich das Bundeskartellamt seit 2014 befasst, auf den Bereich der Rindermast keine durchgreifenden wettbewerblichen Bedenken. Das wichtigste Element dieser Initiative ist die Zahlung eines einheitlichen Preisaufschlags an Tierhalter, die bestimmte Tierwohlkriterien erfüllen, um so die Verbesserung der Haltungsbedingungen zu belohnen. Dieser Preisaufschlag wird durch die Lebensmitteleinzelhandelskonzerne finanziert. Auch wenn das Bundeskartellamt der Vereinbarung eines einheitlichen Preisaufschlags kritisch gegenüberstand, toleriert es diesen aufgrund des Pioniercharakters des Projekts für eine Übergangsphase, die nun bis 2024 verlängert wurde. Für die Zeit danach ist ITW aufgerufen, ein Finanzierungsmodell mit stärker wettbewerblichen Elementen zu präsentieren. Das Bundeskartellamt will sich dann auch vertieft mit einer möglichen Anwendbarkeit von Art. 210 a GMO befassen.
Auch einer vergleichbaren Initiative für mehr Tierwohl in der Milcherzeugung der "Branchenvereinbarung Milch" des QM-Milch e.V. gab das Bundeskartellamt grünes Licht. Im Mittelpunkt der Initiative steht die Einführung eines Labels für Produkte, welche die Tierwohlkriterien des QM+-Programms erfüllen. Die anfallenden Mehrkosten sollen mittels eines sogenannten Tierwohlaufschlages für die Erzeuger finanziert werden. Vor dem Hintergrund, dass im Bereich Milch eine Vielzahl von Konkurrenzlabeln existiert, zwischen diesen Marken intensiver Wettbewerb besteht und nur ein Teil der Molkereien an dem QM+-Programm teilnimmt, kam das Bundeskartellamt zu einer positiven kartellrechtlichen Bewertung der Initiative. In dieser Entscheidung zeigte sich bereits die Bedeutung des auf europäischer Ebene neu eingeführten Art. 210 a GMO für die kartellrechtliche Beurteilung von Nachhaltigkeitsinitiativen in der Agrarindustrie. So sei nach Ausführungen des Bundeskartellamts die Entscheidung, die Initiative für mehr Tierwohl in der Milcherzeugung zu tolerieren, auch "im Lichte" des Art. 210 a GMO erfolgt.
Dagegen bewertete das Bundeskartellamt das vom Agrardialog Milch vorgestellte Finanzierungskonzept, nach dem Preisaufschläge zugunsten von Rohmilcherzeugern zwischen den Erzeugern, Molkereien und Lebensmitteleinzelhandel vereinbart werden sollten, als Verstoß gegen das Kartellverbot. Nach Ansicht des Bundeskartellamts diene das Konzept allein der Sicherstellung eines höheren Einkommensniveaus für Milcherzeuger, ohne aber Nachhaltigkeitsaspekte zu berücksichtigen. Aufgrund des fehlenden Beitrags zu einem höheren Nachhaltigkeitsstandard käme auch keine Freistellung dieser Vereinbarung nach Art. 210 a GMO in Betracht, zumal auch die Unerlässlichkeit der Beschränkung in Frage stünde.
Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamts, hat wiederholt hervorgehoben, das Kartellrecht stehe "Kooperationen zum Erreichen von Nachhaltigkeitszielen nicht im Wege". Dementsprechend zeigen die soeben erörterten Beispiele aus der Entscheidungspraxis eine grundsätzlich wohlwollende Einstellung des Bundeskartellamts zu Nachhaltigkeitsinitiativen. Gleichzeitig wird durch die Entscheidung zum Agrardialog Milch deutlich, dass das Bundeskartellamt nicht bereit ist, Kooperationen von Wettbewerbern, die unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit zu einer Wettbewerbsbeschränkung führen, einen Freifahrtschein zu erteilen. Nichtsdestotrotz bringt der fallspezifische Ansatz des Bundeskartellamts Rechtsunsicherheiten bei der kartellrechtlichen Bewertung von Nachhaltigkeitsinitiativen mit sich, während die wettbewerbspolitische Agenda 2025 des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz das Ziel formuliert, "den Unternehmen einen klaren Rechtsrahmen für Nachhaltigkeitskooperationen zu bieten."
III. FAZIT UND AUSBLICK
Die fortlaufende Befassung des Bundeskartellamts und der Kommission mit dem Thema Nachhaltigkeit und Wettbewerb verdeutlichet, dass die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitszielen in der behördlichen Kartellrechtspraxis einen starken Bedeutungszuwachs erfahren hat. Zudem machen die Veröffentlichungen der Wettbewerbsbehörden deutlich, dass das Bedürfnis von Unternehmen nach Rechtssicherheit in Bezug auf nachhaltigkeitsfördernde Kooperationen ernstgenommen wird.
Auch in anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sind spannende Ansätze bei der kartellrechtlichen Behandlung von Nachhaltigkeitsvereinbarungen zu beobachten. Der österreichische Gesetzgeber hat die Ausnahme vom nationalen Kartellverbot dahingehend erweitert, dass eine "ausreichende Beteiligung der Verbraucher" auch dann gegeben sei, wenn der vorausgesetzte Gewinn, der aus der Verbesserung der Warenerzeugung oder -verteilung oder der Förderung des technischen/wirtschaftlichen Fortschritts entsteht, wesentlich zu einer ökologisch nachhaltigen oder klimaneutralen Wirtschaft beiträgt. Es bleibt abzuwarten, ob sich der deutsche Gesetzgeber – wie in der Agenda 2025 angekündigt – für den Erlass vergleichbarer Rechtsvorschriften in Deutschland entscheidet.
Die Horizontal-LL, die Anfang 2023 in Kraft treten sollen, sind ein erster wichtiger Schritt hin zu mehr Rechtssicherheit. Die Kommission hat zudem in ihrem Competition Policy Brief ihre Bereitschaft betont, auf Antrag Nachhaltigkeitsinitiativen zu prüfen und darüber hinaus Entscheidungen zu erlassen, in denen sie feststellt, dass bestimmte Vorschriften des Kartellrechts nicht auf Nachhaltigkeitsinitiativen anwendbar sind. Dies eröffnetet kooperationswilligen Unternehmen im Einzelfall die Möglichkeit, Rechtssicherheit für die angestrebte Nachhaltigkeitsinitiative zu erreichen. Für Unternehmen, die im Rahmen von Nachhaltigkeitsinitiativen kooperieren wollen, ist eine umfassende kartellrechtliche Prüfung und ggf. eine Abstimmung dieser Initiativen mit den Kartellbehörden der beste Weg für eine kartellrechtskonforme und rechtssichere Ausgestaltung ihrer Kooperationsvorhaben für mehr Nachhaltigkeit.
Der Blogbeitrag steht hier für Sie zum Download bereit: Still hot – Neue Entwicklungen bei der kartellrechtlichen Beurteilung von Nachhaltigkeitsvereinbarungen auf europäischer und deutscher Ebene
Kontakt
Dr. Silke Möller
Partner | Competition | Rechtsanwältin seit 2007
Kontakt
Telefon: +49 211 20052-130
Telefax: +49 211 20052-100
E-Mail: s.moeller(at)glademichelwirtz.com